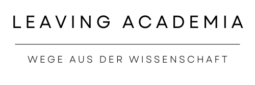Wenn Wissenschaftler*innen darüber nachdenken, ihre Karriere außerhalb der akademischen Welt fortzusetzen, höre ich immer wieder ähnliche Bedenken: „Ich möchte nicht für die freie Wirtschaft oder Industrie arbeiten. Ich könnte nicht ertragen, Teil eines Systems zu sein, das nur auf Profit ausgerichtet ist.“
Dieser Gedanke ist nachvollziehbar – schließlich sehen viele die Wissenschaft als einen Bereich, in dem es um Wissen, Bildung und gesellschaftlichen Fortschritt geht, nicht um Geld. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Auch Universitäten und Hochschulen sind keineswegs frei von wirtschaftlichen Interessen.
Die wirtschaftliche Realität der Hochschulen
In Deutschland arbeiten zahlreiche Universitäten mit Unternehmen zusammen – darunter nicht selten auch solche aus der Rüstungsindustrie. Diese Partnerschaften sind oft lukrativ und sichern Drittmittel, die für die Forschung unverzichtbar geworden sind. Es ist kein Geheimnis, dass Hochschulen dadurch an Einfluss gewinnen, sich aber auch in Abhängigkeiten begeben. Die Vorstellung einer „wertfreien Wissenschaft“ wird hier schnell relativiert.
In Ländern wie den USA oder Großbritannien ist das noch deutlicher zu sehen. Dort agieren Universitäten oft wie Unternehmen: Sie müssen Studierende als zahlende „Kundinnen“ gewinnen, und ihre Existenz hängt von der Attraktivität ihrer Angebote und dem Erfolg ihrer Absolventinnen ab. Rankings und Spendenkampagnen spielen eine zentrale Rolle, und auch hier ist der Profitgedanke allgegenwärtig.


Ist die Industrie wirklich „schlimmer“?
Im Vergleich zur Wissenschaft wirkt die freie Wirtschaft für viele abschreckend, weil sie offen auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist. Doch ist das wirklich so anders? Unternehmen und Universitäten verfolgen beide Ziele, die auf finanziellem Erfolg basieren. Der Unterschied ist, dass die Wirtschaft offener mit diesem Ziel umgeht, während die Wissenschaft es oft hinter Idealen wie Bildung und Forschung versteckt.
Das bedeutet nicht, dass die Wissenschaft per se schlecht ist – ganz im Gegenteil. Aber es zeigt, dass auch Hochschulen wirtschaftliche Interessen haben, die sich nicht immer mit den Werten einzelner Forschender decken.
Die Frage nach der eigenen Verantwortung
Wenn Klient*innen mir von ihrer Abneigung gegen die freie Wirtschaft erzählen, hinterfrage ich gerne gemeinsam mit ihnen, wo genau ihre persönlichen Grenzen liegen. Ist es der Gedanke, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen? Ist es die Sorge, weniger intellektuelle Freiheit zu haben? Oder ist es die Angst, in einem System zu arbeiten, das sie als unethisch empfinden?
Diese Fragen helfen dabei, die eigenen Werte besser zu verstehen – und zu erkennen, dass es in der freien Wirtschaft genauso wie in der Wissenschaft Grauzonen gibt. Es gibt Unternehmen, die nachhaltig, ethisch und gesellschaftlich verantwortlich handeln. Genauso wie es Universitäten gibt, deren wirtschaftliches Handeln fragwürdig ist.
Fazit: Werte sind der Schlüssel
Der Wechsel aus der Wissenschaft ist keine Entscheidung zwischen „gut“ und „böse“. Vielmehr ist es eine Gelegenheit, sich über die eigenen Werte und Prioritäten klar zu werden. Ob in der Wissenschaft oder in der freien Wirtschaft – die Herausforderung besteht darin, einen Weg zu finden, der sowohl mit den eigenen Prinzipien als auch mit den praktischen Gegebenheiten des Lebens vereinbar ist.
Vielleicht lohnt es sich, weniger auf das System zu schauen und mehr darauf, wie man selbst in diesem System wirken kann. Denn am Ende geht es nicht nur darum, wo du arbeitest, sondern wie du arbeitest – und welchen Beitrag du leisten möchtest.